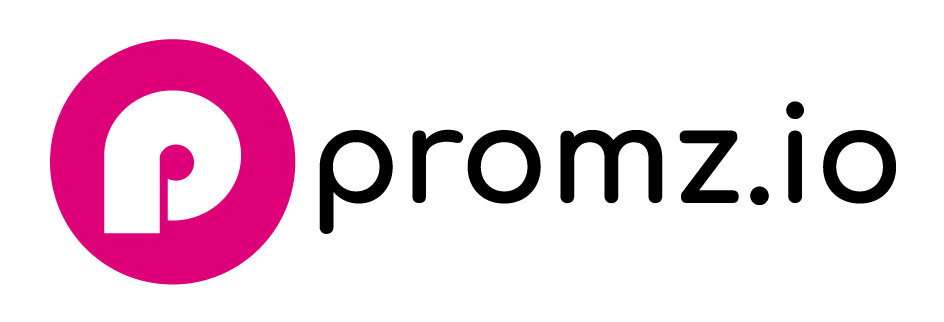Für den 21. April rechnet Paisley Park bei Minneapolis mit einem Strom an Besuchern, der an eine Pilgerfahrt erinnern dürfte.
Im alten Anwesen und Plattenlabel von Prince dürfen Fans von der Musiklegende noch einmal Abschied nehmen. Draußen vor dem Eingang ist Platz für Blumen und Erinnerungsstücke. Drinnen im lichtdurchfluteten Atrium wird die Asche des Sängers, der vor fünf Jahren starb, ausgestellt.
Der Paisley Park, am Rande der Großstadt Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota, war Princes Wohn- und Arbeitsplatz, seine Zufluchtsstätte. Hinter den dicken Mauern des Komplexes versammelte er auf rund 6000 Quadratmetern alle seine Habseligkeiten, seine Auszeichnungen, Kostüme und Instrumente, und baute sich ein Musik-Paradies mit mehreren Aufnahmestudios, Bühnen und Videoproduktionsräumen.
Paisley Park war ein zentraler Bestandteil im Leben des legendären Musikers – und auch an dessen Todestag: Prince wurde am 21. April 2016 im Aufzug des heutigen Museums leblos aufgefunden und kurz darauf für tot erklärt. Eine Überdosis Schmerzmittel, auch wenn die genauen Umstände immer noch nicht geklärt sind. Prince wurde 57 Jahre alt.
Fünf Jahre sind vergangen, und noch immer wird das musikalische Genie Prince Roger Nelson – Sohn eines schwarzen Jazz-Musikers und einer weißen Sängerin – mehr als nur vermisst. Seine Mixtur aus Funk, Pop, Blues und Rock, das explosive Gitarrenspiel, diese sinnliche, oft ins Falsett aufsteigende Soul-Stimme, die teilweise frivolen, auf dem US-Index stehenden Texte elektrisieren seine Fans bis heute. Von Prince stammen Hits wie «Purple Rain», «Kiss» oder «Sign O‘ The Times», die niemals in Vergessenheit geraten werden.
Prince, geboren am 7. Juni 1958, galt seit seinem Debüt mit dem Album «For You» (1978) als musikalisches Wunderkind. Mit 19 Jahren war der Multi-Instrumentalist der jüngste Künstler, dem das Label Warner ein Album in völliger Eigenregie gestattete. Die Texte der ersten Platten lasen sich wie feuchte Träume eines Teenagers. Die sowohl schwarze als auch weiße Sounds aufgreifende Musik dazu – inspiriert von James Brown, Jimi Hendrix, Curtis Mayfield oder Sly Stone, aber eben auch von den Beatles – klang indes enorm reif.
Mit dem ambitionierten Doppel-Album «1999» und Tanzflächenfegern wie dem Titelsong oder «Little Red Corvette» kam 1982 der Durchbruch. Der Soundtrack zum Film «Purple Rain» vollendete zwei Jahre später den Aufstieg zum Superstar. Derweil wurden die Live-Shows des kaum 1,60 Meter kleinen Prince zu energiegeladenen knallbunten Messen des exzentrischen Genies.
Doch es blieb nicht großartig. Und das hat viel mit jener bizarren Sprunghaftigkeit zu tun, die den enorm begabten Künstler zunächst zu größter Kreativität antrieb und später zu wenig karrierefördernden Entscheidungen. So überwarf sich der als arrogant geltende Prince mit Plattenfirmen, schrieb sich im Ringen um Selbstständigkeit «Slave» (Sklave) auf die Wange und änderte diverse Male seinen Künstlernamen – schrägstes Beispiel: TAFKAP, «The Artist formerly known as Prince».
Zuletzt waren seine Platten bisweilen nur noch online zu beziehen, er verramschte eine neue CD auch mal als Zeitungsbeilage. Und die Welthits und kreativen Höhepunkte blieben weitgehend aus. Schlagzeilen machte Prince nun mit seiner Nähe zu den Zeugen Jehovas und auch immer wieder mit Gerüchten über Affären – mit Kim Basinger, Madonna, Carmen Electra, Sheena Easton. Zweimal war er verheiratet – mit weniger bekannten Frauen.
Sein Tod kam schließlich unerwartet – auch, weil Prince bis zum Schluss wie ein Mann ewiger Jugend aussah. Als solcher werden ihn auch seine Fans in Erinnerung behalten, wenn sie ihrem Idol am 21. April im Paisley Park gedenken. Elektrisiert hatte seine Anhänger zuletzt die Ankündigung eines bisher unveröffentlichten Albums: «Welcome 2 America» soll am 30. Juli erscheinen – und könnte das Lebenswerk des Unvollendeten zumindest etwas abrunden.