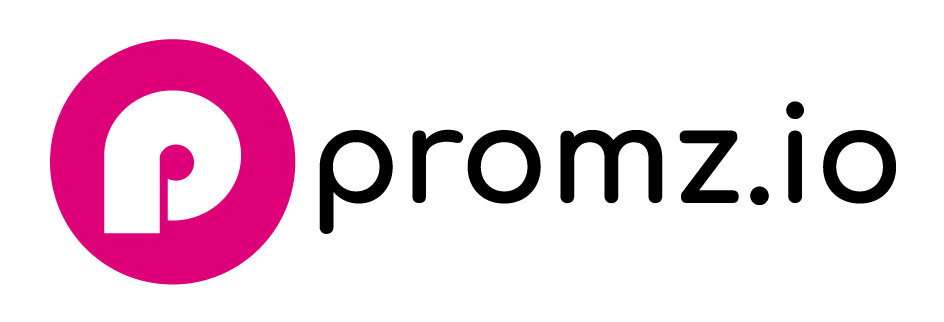Der Zweite Weltkrieg war erst ein halbes Jahr vorbei. Einige Monate zuvor hatte Nazi-Deutschland kapituliert, die Städte des Landes waren noch immer zerstört.
Trotzdem fiel in Berlin die erste Klappe für den ersten Nachkriegsspielfilm: Am 16. März 1946 begannen die Dreharbeiten für «Die Mörder sind unter uns» mit der jungen Hildegard Knef – mitten in den Trümmern.
Gleich in den ersten Szenen wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Der ehemalige Militär-Chirurg Dr. Hans Mertens (E.W. Borchert) läuft durch die Ruinen. Am Straßenrand liegen Berge von Steinen, von den Häusern sind nur noch einzelne Wände oder geisterhafte Strukturen übrig, die wie Mahnmale zum Himmel ragen. Mittendrin spielen Kinder.
Es ist allerdings keine Dokumentation, die Regisseur Wolfgang Staudte so drehte. Er nutzte diese Anblicke vielmehr als stimmungsvolle Kulisse für seinen in Schwarz-Weiß eingefangenen Film – und als Symbol für die kaputten Menschen, die dort leben. Staudte zeigt Männer, die im Krieg einen Arm oder ein Bein verloren. Und er erzählt von Menschen, die innerlich gebrochen sind.
Einer von ihnen ist Mertens. Er wird von seinen Kriegserlebnissen verfolgt und versucht, seine Erinnerungen mit Alkohol zu betäuben. Er lebt in der Wohnung von Susanne Wallner (Knef, die damals erst 21 Jahre alt war und durch den Film international bekannt wurde). Sie ist eine KZ-Überlebende, die nach Berlin zurückkehrt. «Ich hatte Angst vor der Freiheit, Angst vor den Menschen», sagt sie. «Es ist schwer zu vergessen.» Sie wolle «endlich einmal leben».
Diese beiden verlorenen und traumatisierten Seelen werden zu einer Schicksalsgemeinschaft. Beide haben überlebt, sind aber nicht wirklich am Leben. Als Mertens dann noch einen ehemaligen Hauptmann wiedertrifft, der im Krieg Dutzende Zivilisten erschießen ließ, will er den Mann umbringen.
Selbstjustiz, die Täter von einst zur Rechenschaft ziehen, mit der eigenen Vergangenheit zurechtkommen und einen Neuanfang schaffen – all diese Themen spricht Regisseur Staudte in dem auf 35 Millimeter gefilmten «Die Mörder sind unter uns» an. Dabei sind auch die filmischen und stilistischen Mittel spannend: Bilder des zerstörten Berlin unterlegt Staudte mit fröhlicher Klaviermusik, in die dunkle, bedrohliche Melodie einfließt. Die Anspannung ist so von Anfang an zu spüren.
Die Kamera ist dabei viel in Bewegung, filmt mal von schräg oben und springt dann plötzlich in die Nahaufnahme. Staudte spielt mit Schärfe und Unschärfe. Die Unruhe der Menschen und der Umbruch in der Gesellschaft werden auf diese Weise mehr als deutlich.
Premiere feierte der Film im Oktober 1946 im sowjetischen Sektor Berlins im Admiralspalast – kurz vor den ersten Urteilen im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Im April 1947 folgte in Baden-Baden die erste Aufführung des Films in den westlichen Besatzungszonen.
Doch auch 75 Jahre nach den Dreharbeiten lohnt es sich, «Die Mörder sind unter uns» anzuschauen. Nicht nur, weil es ein wichtiges Stück deutscher Filmgeschichte ist. Immerhin ermöglicht das Werk zugleich einen so authentischen wie mahnenden Blick zurück in die Geschichte und macht eindringlich die Folgen eines Krieges klar – bei der Zerstörung der Städte genauso wie für die Menschen.