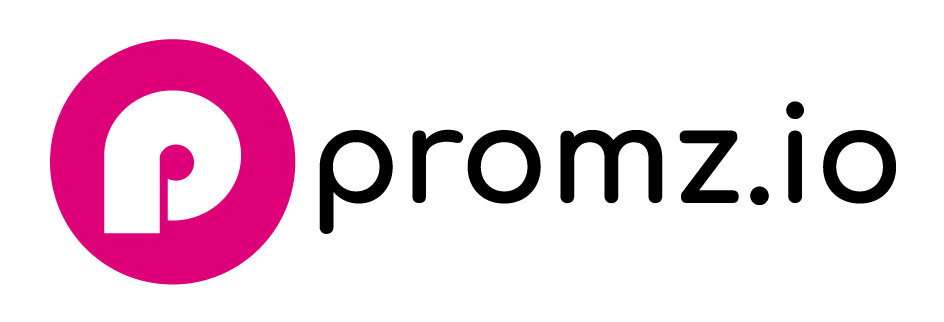Ein Film von erschreckender Relevanz
In dem Film ‚Jud Süss – Film ohne Gewissen‘ stellt Tobias Moretti als Ferdinand Marian die Frage an seine Frau, wie ihr das Drehbuch gefalle. Ihre Antwort ist: ‚Schlecht ist es nicht, aber furchtbar.‘ Diese Charakterisierung spiegelt die ambivalente Wahrnehmung des Films wider.
Vor 85 Jahren, zwischen März und Juni 1940, führte der Regisseur Veit Harlan, der später wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wurde, die Dreharbeiten zu dem antisemitischen Spielfilm ‚Jud Süß‘ durch. Der Film erlangte auch nach der Zeit des Nationalsozialismus eine gewisse Popularität.
Premiere in Venedig und die Rezeption des Films
Am 5. September 1940 wurde der Film unter der Aufsicht von Joseph Goebbels bei den Filmfestspielen in Venedig uraufgeführt. Eine Woche später fand die Premiere in Berlin statt, und insgesamt zählte man mehr als 20 Millionen Kinobesucher. In den von Deutschland besetzten Gebieten wurde der Film häufig vor Deportationen von Juden gezeigt, um die Täter zu enthemmen.
Nach dem Krieg war ‚Jud Süß‘ zunächst verboten und gehört seit fast 60 Jahren zu den Vorbehaltsfilmen der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die Aufführungen nur im Rahmen von einführenden Vorträgen und anschließenden Diskussionen gestattet.
Drehbuch und Inhalte
Der Film erzählt eine verzerrte Geschichte des Bankiers Joseph Ben Issachar Süßkind Oppenheimer, der 1738 in Stuttgart hingerichtet wurde. Harlan beruft sich dabei auf den Roman ‚Jud Süß‘ von Lion Feuchtwanger, dessen zeitgenössische Erzählweise jedoch differenzierter war.
Der Harlan-Film zeigt Oppenheimer als eine Figur, die zahlreiche antisemitische Klischees verkörpert, darunter Habgier und Hinterlist. Die Handlung folgt Oppenheimer, der vom Herzog von Württemberg an den Hof berufen wird und dort seine Macht ausnutzt. Der Film endet mit seiner Hinrichtung und einem Aufruf zur Vertreibung aller Juden aus Württemberg.
Nachwirkungen und heutige Relevanz
Der britische Historiker Bill Niven argumentiert, dass der Film in der Nachkriegszeit als Anti-Israel-Propaganda verwendet wurde, insbesondere in den 1950er und 60er Jahren im Nahen Osten. Er betont, dass der Film weiterhin relevante antisemitische Stereotypen transportiert, die auch heute noch in verschiedenen Kontexten sichtbar sind.
Niven fordert eine wissenschaftlich kommentierte Fassung des Films, um die Gefahren von antisemitischen Narrativen zu entlarven. Er weist darauf hin, dass die Themen des Films, wie die Vorstellung von Juden als ‚Kolonisatoren‘, bis heute bestehen und eine besorgniserregende Aktualität besitzen.
‚Jud Süß‘ ist 85 Jahre alt, bleibt jedoch ein unerledigtes Kapitel in der Geschichte des Antisemitismus. Historiker warnen vor der Verbreitung dieser Ideologien in verschiedenen politischen Spektren, sowohl rechts als auch links.