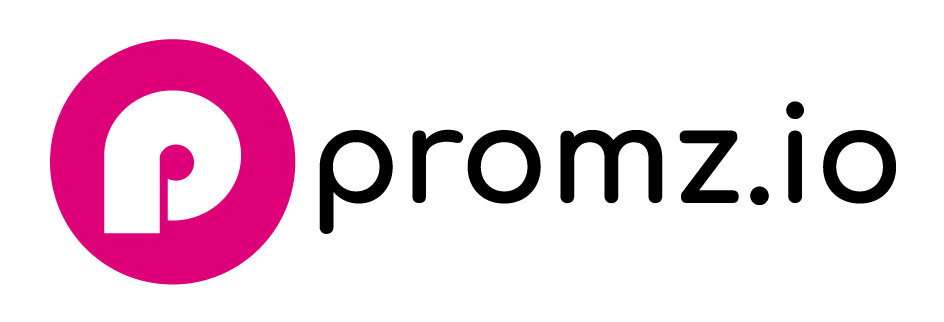Als Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin übernimmt die international gefeierte Joana Mallwitz erstmals die Verantwortung für ein großes Sinfonieorchester.
Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin schildert die 34-Jährige ihre Beweggründe. Und wie ihre Liebe zur Oper darunter nicht leiden soll.
Frage: Sie werden auch für Ihre Arbeit an Opern gefeiert. Was hat Sie bewogen, zu einem Konzertorchester zu wechseln?
Antwort: Wenn der Vertrag in Nürnberg im Jahr 2023 ausläuft, werde ich 18 Jahre in Festanstellungen an Opernhäusern gearbeitet haben, davon die Hälfte in leitender Funktion. Dann wird es Zeit sein für einen Fokuswechsel. Die Position als Chefdirigentin des Konzerthausorchesters ist daher für mich doppelt spannend, da es zum ersten Mal eine Stelle bei einem reinen Sinfonieorchester ist.
Frage: Wie viel Platz ist dann noch für die Oper?
Antwort: Ich liebe die Oper und werde auch nach wie vor Opern dirigieren, aber eben als Gast. Ein Opernengagement bedeutet immer auch, mehrere Wochen am Stück in einer anderen Stadt die Zelte aufzuschlagen. Natürlich wird ab 2023 der Schwerpunkt meiner Arbeit in Berlin liegen, da muss man schauen, wie viel ich überhaupt nebenbei machen kann. Es wird aber nicht so sein, dass ich ab 2023 der Oper Goodbye sage. Es kommen viele interessante Angebote von verschiedenen Häusern, auch international.
Frage: Muss sich klassische Musik mehr öffnen?
Antwort: Generell denke ich, dass die Identifikation einer städtischen Gesellschaft mit den Orchestern und Opernhäusern der Stadt äußerst wichtig ist. Um dies zu stärken, müssen wir uns immer wieder aus unserer Komfortzone herauswagen, manchmal einfach auch neu denken, sich trauen, ins Gespräch zu kommen, neue Sachen auszuprobieren, neue Formate auszuprobieren, neue Begegnungen auszuprobieren. Was ich aber immer wieder betone, ist, dass wir nicht den einen großen Denkfehler machen dürfen, nämlich «Musikvermittlung» mit der Verwässerung des Inhalts zu verwechseln. Wenn das Konzert nicht gut ist, bringt auch alle Vermittlung nichts.
Frage: Was hat die Pandemie in Ihrem Bereich bewirkt?
Antwort: Corona war und ist für die klassische Musik und ihre Ausführenden eine enorme und bedrohliche Krise. Aber wir waren gezwungen, sehr spontan zu denken, kurzfristig umzuplanen, flexibel und bis hin zur Belastungsgrenze offen zu bleiben und outside the box zu denken. Da hat man eben auch gesehen, dass das theoretisch möglich ist, wenn man ein bisschen die gefestigten Pfade verlässt. Ein bisschen etwas davon sollte man beibehalten, diese Art von Offenheit, Flexibilität und Risikobereitschaft. Den Mut, die Möglichkeit des Scheiterns zu riskieren und dadurch vielleicht erst zur Lösung zu kommen.
Frage: Welche Rolle spielt das Publikum für Ihre Arbeit?
Antwort: Musik entsteht immer erst dann, wenn sie auch auf Ohren trifft. Das ist ja das Magische, dieses gemeinsame Erleben von Musizierenden und Hörenden, die sich aufeinander einschwören und sich gegenseitig versichern: Wir gehen da jetzt zusammen durch diese Erfahrung, auch wenn das Stück anderthalb Stunden dauert. An manchen Abenden kann man erleben, wie so viele Menschen durch die Musik auf eine Wellenlänge kommen.
Frage: Sie wollen nicht zu viel Ego am Dirigentinnenpult. Sind Sie eher der Kumpeltyp?
Antwort: Das Gegenteil von zu viel Ego am Pult ist ja nicht der Kumpeltyp, sondern dass es einfach nur um die Sache geht. Und das ist schwer genug. Es klärt sich in den allerersten Minuten, ob das klappt mit einer Dirigentin oder einem Dirigenten und den Musikern – oder nicht. Die Autorität, die man braucht, kommt nicht durch autoritäres Verhalten, sondern einzig und allein durch Vorbereitung und Authentizität. In dem Moment ist für Ego überhaupt gar kein Platz.
Frage: Philharmoniker, Staatskapelle und Konzerthausorchester sind Berliner Ensembles mit Weltruf. Damit stehen Sie künftig in einer Reihe mit ihren Dirigentenkollegen Kirill Petrenko und Daniel Barenboim. Wie groß ist der Erfolgsdruck?
Antwort: Natürlich ist Berlin ein unvergleichliches, reiches kulturelles Pflaster. Als Musiker ist man sich natürlich schon sehr bewusst, was für große Erwartungen an einem solchen Ort gestellt werden. Man kann das aber nicht als Ausgangspunkt für seine Arbeit nehmen, ich gehe an meine Aufgabe mit den gleichen Grundlagen heran wie immer.
Frage: Warum gibt es noch immer so wenige Dirigentinnen auf leitenden Positionen?
Antwort: Ich sehe auf der einen Seite, dass sich gerade erst in den letzten Jahren sehr viel verändert hat und ich wirklich viele fantastische Kolleginnen habe, die im Beruf erfolgreich ihren Weg gehen. Andererseits wundert es mich immer wieder, wo man überall noch die erste Frau sein kann.
Frage: Welche Rolle spielt die MeToo-Debatte um den Missbrauch männlicher Machtpositionen in ihrem Metier?
Antwort: Es ist wichtig, dass man Dinge, die Umgangsformen, Führungsstil und Machtmissbrauch betreffen, anspricht, damit es kein Tabu mehr für die Betroffenen ist. Das hat MeToo bewirkt und es ist eine Entwicklung, die gut ist, da sie den Druck auf die Institutionen vergrößert hat, die Sachen wirklich nachzuverfolgen und nicht einfach wegzuschauen. Und das muss unbedingt weitergehen.
ZUR PERSON: Joana Mallwitz gilt als ein Ausnahmetalent. In Hildesheim geboren, begann sie als 13-Jährige ihre musikalische Ausbildung, studierte Dirigieren und Klavier in Hannover. Mit 19 Jahren ging sie als Solorepetitorin zum Theater Heidelberg, wo sie schnell zur Kapellmeisterin aufstieg. 2014 wechselte sie als damals jüngste Generalmusikdirektorin Europas ans Theater Erfurt. Vier Jahre später übernahm sie diese Position am Staatstheater Nürnberg. 2019 wurde sie Dirigentin des Jahres. In zwei Jahren wird Mallwitz Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin.