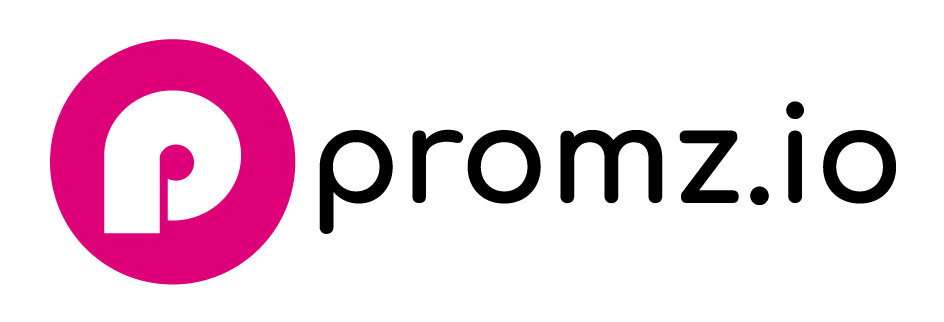Dass sich gefühlt alle Menschen auf einen Film einigen können, ist selten. Als «Poor Things» mit Emma Stone Premiere feierte, passierte das: Einhellig lobten Kritik und Publikum die Komödie als fantasievoll-feministischen Geniestreich.
Stone spielt darin eine Art modernes Frankenstein-Monster, das sich von seinem Schöpfer emanzipiert. Nun kommt «Poor Things», der beim Filmfestival Venedig den Hauptpreis und kürzlich zwei Golden Globes gewann, in die deutschen Kinos. Was macht den Film so besonders?
Emma Stone auf Oscar-Kurs
Erstmal wären da die Schauspielerinnen und Schauspieler. Emma Stone legt eine brillante Performance hin, die ihr kürzlich einen der erwähnten Globes einbrachte und sicher bald auch die Oscar-Nominierung. Die 35-Jährige spielt eine erwachsene Frau namens Bella, der ein Wissenschaftler das Gehirn ihres Babys eingesetzt hat. Sie lernt neu, zu sprechen und sich zu bewegen. Das Filmpublikum kann sich auf viel Körper-Slapstick und Sprachspiele freuen.
Willem Dafoe spielt den Wissenschaftler Godwin, genannt God. Er hat Bellas leblosen, schwangeren Körper nach einem Selbstmordversuch gefunden und beschlossen, sie wiederzubeleben und ihr das Baby-Gehirn einzupflanzen. Dafoe spielt Godwin als Mann mit flexibler Moral, wissenschaftlichem Genie und einer trotz allem nicht zu leugnender Väterlichkeit.
Gaudí auf Acid: Wahnwitzige, fantasievolle Optik
Ein weiterer Reiz von «Poor Things» (und der Grund, warum man den Film eher im Kino als zu Hause ansehen sollte): Die Optik ist so berauschend wie überfordernd. Godwin und Bella leben in einer surrealistischen Jugendstil-Villa. Vermutlich im 19. Jahrhundert, aber so ganz klar ist das nicht. Nicht nur das Haus, sondern das gesamte Setdesign sieht aus, als hätte es der Architekt Gaudí auf einem Acid-Trip designt, wie kürzlich eine Journalistin des Magazins «Literary Hub» schrieb.
Möbel, Schiffe oder Häuser sind fantasievoll gekrümmt oder geschwungen und voller verspielter Details. Ventilatoren sehen aus wie Blumen, Säulen sind gezwirbelt. An den Wänden finden sich in Satin gestickte Figuren, die Böden sind aus gepolstertem Samt.
Regisseur Giorgos Lanthimos nutzt außerdem eine Fish-Eye-Linse und spielt mit weiteren Kamera-Techniken, so dass das Bild öfter mal gekrümmt oder verschwommen ist. Teile des Films sind in kräftigsten Farben, Teile in Schwarz-Weiß. Dazu kommen prächtige Kostüme: Bella trägt Morgenmäntel, Kleider und sogar einen Arztkittel mit megalomanischen Puffärmeln. Die Stoffe sind schimmernd und bestickt, voller Rüschen, sehen aus wie Puppenkostüme.
Pop-Feminismus wie bei «Barbie»
Stichwort Puppe: Die Kern-Geschichte von «Poor Things» ist die einer Frau, die von verschiedenen Männern wie ein Objekt behandelt wird und sich daraus befreit. Da wäre Godwin, der sie als Studienobjekt in seinem Haus halten will. Dann ist da ein schmieriger Anwalt namens Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), der sich Bellas erwachten Sextrieb zunutze macht, sie aus dem Haus befreit und mit ihr auf Reisen geht – und nach einem anfänglichen Orgasmus-Reigen daran verzweifelt, dass Bella ihre Lust nicht nur mit ihm auslebt. Da Bella abgeschottet von der Außenwelt aufgewachsen ist, kennt sie keine gesellschaftlichen Konventionen wie Höflichkeit, auch Monogamie ist ihr fremd.
Als Duncan (der ihr anfangs noch arrogant riet, sich bloß nicht in ihn zu verlieben) immer eifersüchtiger wird, stellt Bella trocken fest: «Dein trauriges Gesicht löst in mir wütende Gefühle zu dir aus.» In Bellas unverstellter Wahrnehmung erscheinen manche Rituale oder Moralvorstellungen der Menschheit bizarr. Scham ist ihr fremd. Sexarbeit probiert sie später im Film unbefangen. Das Konzept eines höflichen Small-Talks bleibt ihr ein Rätsel. Vor allem aber lässt sie die Männer um sich herum wie jämmerliche, besitzergreifende Witzfiguren erscheinen.
«Poor Things» vertritt eine oft sehr witzige, gleichsam recht überdeutliche und poppige Version von Feminismus. Und trifft damit den Zeitgeist: Vergleiche mit dem ähnlich verfahrenden Kinohit «Barbie» wurden gefällt und sind nachvollziehbar.
Die Sache mit dem Sex
Wer lachen und ob der fantasievollen Optik staunen will, ist in «Poor Things» sicher richtig. Empfindlich sollte man vielleicht nicht sein. Es wird schonmal ein Gehirn wie ein Kuchen in Scheiben geschnitten, oder Bella hackt genüsslich mit einem Messer in den Organen eines toten Menschen herum.
Sehr viel Nacktheit ist auch zu sehen. Und an dieser Stelle ließe sich vielleicht ein wenig Kritik üben. Ein bisschen wirkt es, als wäre Bellas sexuelle Lust – die viele, sehr viele Szenen des Films bestimmt – aus einem männlichen Blick geschrieben. Bei ersten Masturbationsversuchen stöhnt sie so genüsslich, als wäre sie eine Porno-Darstellerin. Der Sex mit ihrem ersten Liebhaber Wedderburn ist rasant und für sie sofort von zahlreichen Orgasmen gekrönt. Ist das aus weiblicher Sicht realistisch?
Am Ende passt diese Darstellung aber vielleicht auch in das Gesamtkonzept der grotesken Komödie «Poor Things», die übrigens auf einem Roman des Schriftstellers Alasdair Gray aus den 1990er Jahren basiert. Lanthimos will hier keine echten Menschen, sondern humoristisch überzeichnete Charaktere zur Schau stellen. Und so auf diverse Alltagspraktiken hinweisen, die uns nach dem Schauen reichlich absurd erscheinen dürften.
Poor Things, Irland/Großbritannien/USA 2023, 141 Min., FSK ab 16 Jahren, von Giorgos Lanthimos, mit Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Margaret Qualley