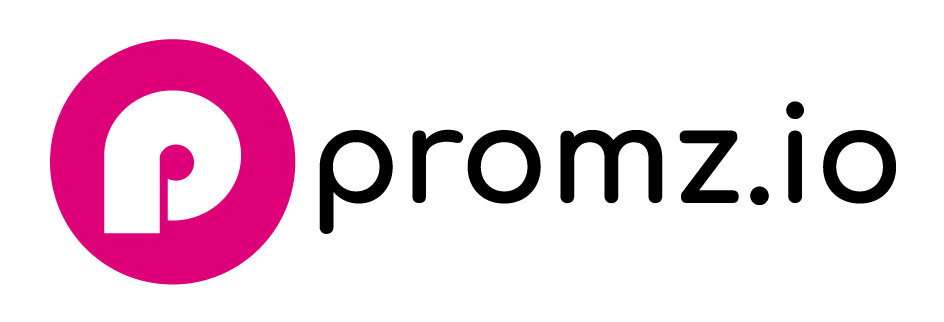Männer mit Maschinengewehren, Panzer, Szenen von brennenden Wäldern und fast immer mit dabei: die Kamera. In einer nahen Zukunft in den USA wollen Journalisten den dort tobenden Bürgerkrieg dokumentieren – und begeben sich dabei selbst in Lebensgefahr.
Der Actionthriller «Civil War» von Alex Garland mit Kirsten Dunst («Spider Man») als Kriegsfotografin in der Hauptrolle zeichnet eine brutale und erschreckend realistische Dystopie einer gespaltenen Nation in der Zukunft – und ist ganz klar als Antikriegsfilm angelegt. Er kommt am 18. April in die Kinos.
An der Seite von Dunst, die souverän die desillusionierte und ausgelaugte Lee spielt, sind auch «Priscilla»-Darstellerin Cailee Spaeny (Jessie) und «Narcos»-Schauspieler Wagner Moura (Joel). Auch sie sind die Chronisten des Bürgerkriegs, dessen Grund – mit Absicht – nie vollends klar wird.
Texas und Kalifornien – die in der realen Welt entlang politischer Linien unterschiedlicher nicht sein könnten – führen die sogenannten Western Forces an, um den diktatorischen Präsidenten in Washington D.C. zu stürzen. Die Journalistengruppe rund um Lee macht sich auf den Weg zum Regierungssitz. Dort wollen sie die Armee-Einheiten, die zum Präsidenten vordringen, eng mit ihren Kameras begleiten.
Erschreckende und fast schon surreale Szenen
Der Actionfilm des britischen Regisseurs Garland («Ex Machina») mutet in weiten Teilen als Roadmovie an. Immer wieder schafft er dabei erschreckende und teilweise schwer zu verdauende Bilder – etwa von einem Massengrab mit den Leichen all jener, die aus der Sicht eines rassistischen Rebellen nicht «typisch amerikanisch» sind. Fast schon surreal wirkt hingegen eine Szene in einer (vermeintlich) friedlichen US-Stadt, die absurderweise meint, sich aus dem Bürgerkrieg heraushalten zu können.
Spannend ist vor allem die Entwicklung von Spaenys Charakter Jessie, die naiv startet und schließlich zu einer skrupellosen Journalistin wird, die im Kriegsgeschehen stets das beste Bildmotiv sucht. Stellenweise ist «Civil War» daher auch als Kritik an Sensationsgier zu verstehen. Als es etwa um die Frage geht, wer das beste Motiv des gestürzten Präsidenten bekommt, ermahnt ein Reporter einen Kollegen, ihm nicht das Titelbild zu stehlen.
Dunst: «Film wirkt auf mich wie eine Fabel»
Trotz der geschauspielerten Grausamkeiten soll der Film keine Ästhetisierung des Kriegs sein, wie man es oft aus Hollywood-Blockbustern kennt. Vielmehr will er dazu anregen, die Realität zu reflektieren. Kirsten Dunst bringt es in einer Pressemitteilung auf den Punkt: «Dieser Film wirkt auf mich wie eine Fabel – wie eine warnende Fabel, was geschieht, wenn Menschen nicht miteinander kommunizieren.»
Es ist eine Art Fabel, deren Moral klar wird («Krieg ist schlimm!»). Doch die wichtigste Frage wird darin nicht beantwortet – nämlich danach, wie es dazu gekommen ist, dass diese Menschen so unerbittlich gegeneinander kämpfen. In den USA ist der Bürgerkrieg der 1860er-Jahre im kollektiven Gedächtnis verankert, damals kämpfte der Süden gegen den Norden entlang der Frage der Sklaverei. Doch «Civil War» ist kein Rückblick.
«Das ist nicht die Gefahr, der die Welt ausgesetzt ist. Sondern wir sind mit der Gefahr eines Zerfalls konfrontiert», sagt Garland laut einer Mitteilung. Fake News, Einseitigkeit, Absolutheit – das sind akute und aktuelle Gefahren, die nicht nur in den USA Menschen auseinanderbringen. Kurz formuliert: «Wenn wir eine gemeinsame Wahrheit verlieren», so Dunst. Unheimlich, weil so realistisch wirken die Szenen, in denen das Weiße Haus gestürmt wird. Die meisten dürften sich noch an die Bilder aus dem echten Leben vom Sturm aufs Kapitol in den USA von vor drei Jahren erinnern.